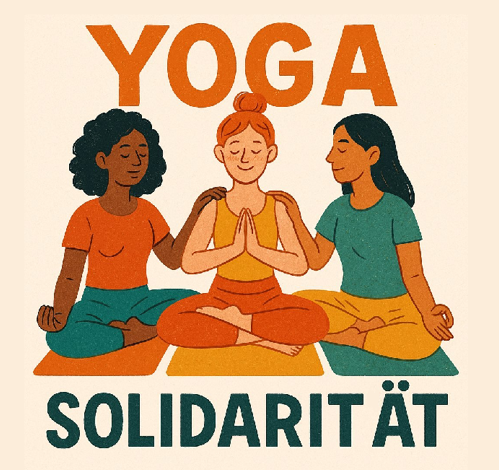Eine Woche nach dem Weltgeflüchtetentag findet das Fest der Begegnung statt, um weiterhin eine solidarische und informative Plattform für die Rechte der Geflüchteten zu schaffen. Es wird Podiumsdiskussionen, Vorträge und sowie Musik und Tanz vom Nachmittag bis in den Abend hinein geben.
Die Veranstaltung wird vom Heval Netzwerk, Amnesty Internation Activism BW und dem SUEDHANG Café organisiert. Mehr Informationen zum Ort und zum Programm finden Sie auf dem Flyer oder auf der Instagramm-Seite des Heval-Netzwerks.