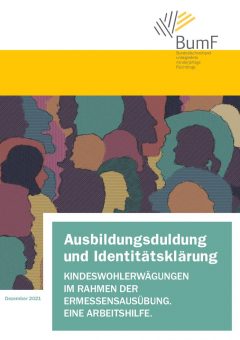Erst jüngst hatte das Wort „Pushback“ weitere traurige Berühmtheit erlangt, als es zum Unwort des Jahres 2021 gekürt wurde. Die Jury begründete ihre Entscheidung damit, dass ein menschenfeindlicher Prozess, der den Menschen auf der Flucht ihr Menschen- und Grundrecht auf Asyl abspricht, durch diesen Begriff beschönigt werde. Tatsächlich haben diese sogenannten Pushbacks an den Außengrenzen der EU im vergangenen Jahr enorm zugenommen. An der Grenze zwischen Griechenland und der Türkei, auf der Balkanroute, in den Wäldern zwischen Belarus und Polen, auf dem Mittelmeer, überall wird verhindert, dass Geflüchtete in Europa Schutz finden können, überall werden diejenigen, die es doch schaffen die Grenze zu überqueren, gewaltsam wieder zurückgedrängt. Die Veranstaltung beschäftigt sich mit der Zunahme an völkerrechtswidrigen Zurückweisungen und wirft einen Blick auf die Situation von Geflüchteten vor Ort und behandelt die politischen Hintergründe dieser Menschenrechtsverletzungen.
Es sprechen und diskutieren:
Jamila Schäfer ist stellvertretende Vorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen und Mitglied des Deutschen Bundestags. Ihre Schwerpunktthemen sind neben der Europapolitik auch die Themen Migration, Flucht und Asyl.
Irina Ganzhorn ist bei der Hilfsorganisation HERMINE e.V. zuständig für Logistik und Auslandsfahrten und ist regelmäßig an den EU-Außengrenzen.
Dr. Bernd Kasparek ist Migrations- und Grenzregimeforscher und arbeitet am Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung und hat erst kürzlich ein Buch zur Grenzschutz-Agentur Frontex veröffentlicht.
Moderiert wird die Podiumsdiskussion von dem Journalisten Christian Jakob (taz), der regelmäßig zu den Themen Flucht und Migration schreibt, u.a. auch Reportagen zur Situation von Geflüchteten an den EU-Außengrenzen.
Die Veranstaltung findet im Hybrid-Format im Bellevue di Monaco, Müllerstraße 2, 80469 München statt und wird auch als Livestream zu sehen sein unter: https://www.pi-muenchen.de/veranstaltungsreihe-muenchen-global-engagiert/
Je nach Infektionsgeschehen ist eine Teilnahme vor Ort möglich. Bitte melden Sie sich über folgendes Formular an: https://forms.office.com/r/0qPgW2hyNJ