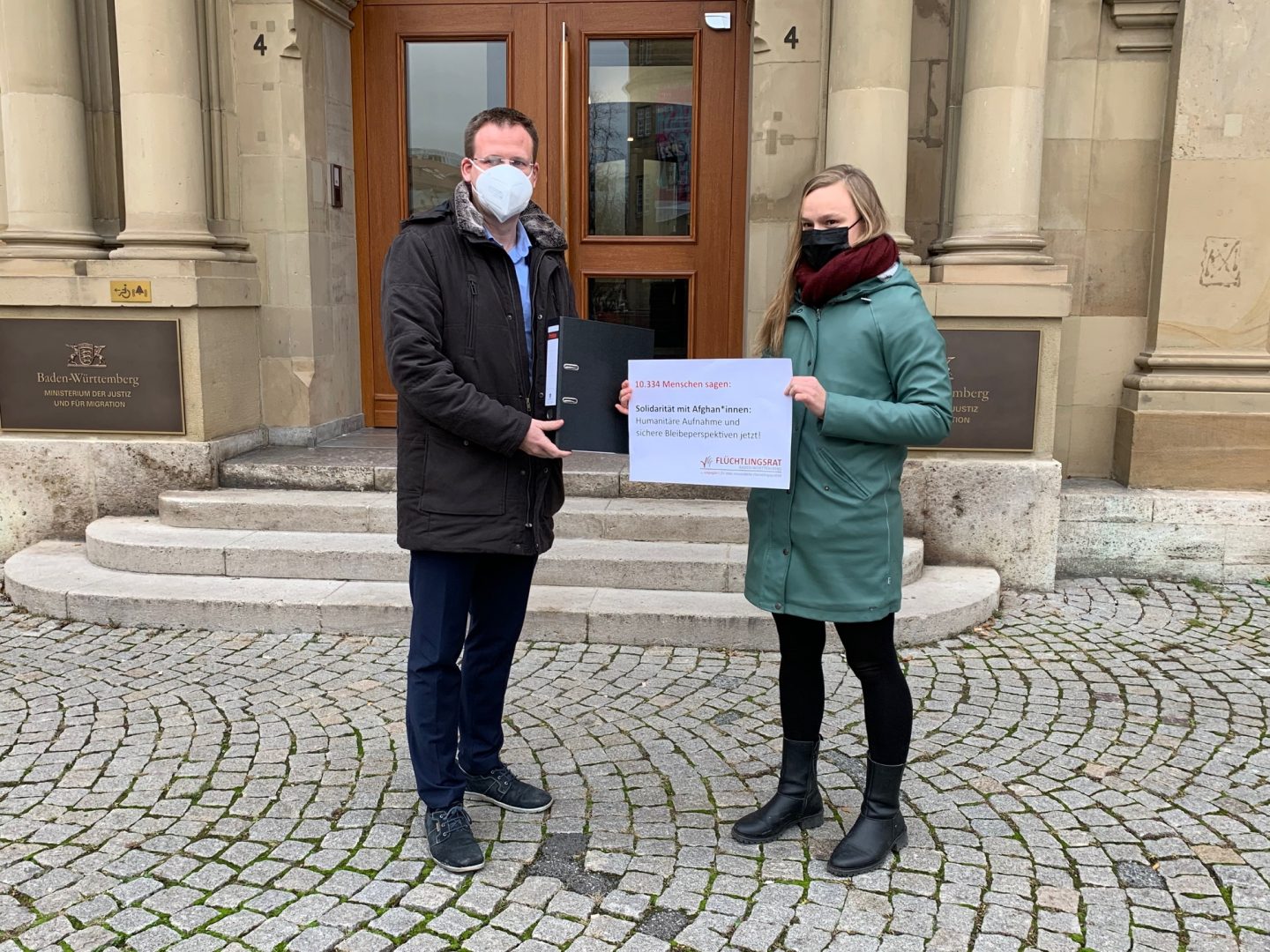Mit einem »Sonder-Asylrecht« für die Grenzstaaten zu Belarus will die Kommission u.a. Grenzverfahren massiv ausweiten. Anstatt gegen Pushbacks an der Grenze vorzugehen, kommt die Kommission den Staaten also stark entgegen. Doch die Beschwichtigungstaktik schlägt fehl: Polen lehnt den Vorschlag ab – und will das Asylrecht vollständig aussetzen.
Menschen die in Wäldern in Eiseskälte ausharren und nicht versorgt werden, Zugangsverbote für Presse und humanitäre Organisationen und gewaltsame Pusbacks – das ist schon den ganzen Herbst über die bittere Realität an den europäisch-belarussischen Grenzen. Europäische Werte und Menschenrechte? Fehlanzeige an vielen Außengrenzen, doch die Offenheit mit der diese Rechtsbrüche insbesondere von der polnischen Regierung vertreten werden hat eine neue Qualität. Gerechtfertigt wird dies, indem schutzsuchende Menschen als »hybride Bedrohung« geframed werden – eine entmenschlichende Sprache, die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in ihrer Rede zur Lage der Union bereits übernahm.
Anstatt wie früher, zum Beispiel mit Vertragsverletzungsverfahren gegen die ungarischen Transitzonen, europäisches Recht zu verteidigen, geht die Kommission mit ihrem am 1. Dezember vorgestellten Vorschlag weitgehend vor der polnischen Regierung in die Knie.
Verschärfung des Asylrechts als Kuhhandel mit Rechtspopulisten
Mit ihrem Vorschlag will die Europäische Kommission den Grenzstaaten zu Belarus – Polen, Lettland und Litauen – eine massive Verschärfung des Asylrechts erlauben. Konkret schlägt die Kommission vor:
- De facto Aussetzung des Asylrechts für 4 Wochen: Das EU-Recht sieht vor, dass Asylanträge bei einer hohen Zahl von Antragsteller*innen spätestens innerhalb von 10 Tagen registriert werden sollen. Dies soll für die Grenzstaaten zu Belarus auf vier Wochen ausgeweitet werden. Griechenland inhaftierte während eines solchen europarechtswidrigen Registrierungsstopps im März 2020 viele Asylsuchende willkürlich unter schlimmen Bedingungen. Es stellt sich auch die Frage, wie Asylsuchende ohne Registrierung vor Pushbacks geschützt sein sollen.
- Massive Ausweitung von Grenzverfahren: Grenzverfahren sollen auf alle Asylsuchenden angewendet werden können und anstatt vier Wochen bis zu vier Monate (16 Wochen) dauern können. Die Kommission geht davon aus, dass die Personen in der Zeit noch als »nicht-eingereist« gelten. Entsprechend ist damit zu rechnen, dass die Betroffenen in geschlossenen Zentren bleiben müssten, um eine solche »Nicht-Einreise« tatsächlich durchzusetzen. Wenn die Phase der Nicht-Registrierung noch dazu gerechnet wird, dann geht es letztlich um bis zu 20 Wochen in denen schutzsuchende Menschen voraussichtlich an den Grenzen festgesetzt werden.
- Absenkung von Unterbringungsstandards: Bei der Unterbringung von Asylsuchenden sollen die drei Mitgliedstaaten nicht mehr die Standards der EU-Aufnahmerichtlinie einhalten, sondern müssen quasi nur das Überleben der Personen sicherstellen.
- Vereinfachte Abschiebungen von der Grenze: Auch beim Thema Abschiebungen sollen Polen, Litauen und Lettland sich nicht an geltendes Recht, die EU-Rückführungsrichtlinie, halten müssen, sondern können hiervon abweichen.
- Registrierungspunkte: Die drei Mitgliedstaaten sollen Orte bestimmen, zum Beispiel konkrete Grenzübergänge, an denen schutzsuchende Menschen ihren Asylantrag stellen können und wo dieser registriert wird. Das wäre zwar wünschenswert, es ist aber angesichts der Politik der polnischen Regierung nicht zu erwarten, dass dies in der Praxis tatsächlich passiert – denn mit Konsequenzen aus Brüssel muss Warschau offensichtlich nicht rechnen.
Diese Sonderregeln sollen für alle Asylsuchenden gelten, die über die Grenze von Belarus in eins der drei Länder kommen oder gekommen sind. Das Sonderrecht soll zunächst für sechs Monate gelten, wobei die Kommission bereits darauf hinweist, dass es auch zu einer Verlängerung kommen könnte.
Keine Überforderung sondern politisches Kalkül
Die Kommission begründet ihren Vorschlag damit, dass die Mitgliedstaaten mit der Umsetzung des gültigen Rechts in der aktuellen Situation überfordert wären – dabei hat insbesondere Polen überhaupt nicht versucht, geltendes Recht bezüglich Asylverfahren und Unterbringungsstandards anzuwenden. Die polnische Regierung hat sich direkt darüber hinweg gesetzt und lässt ihre Grenzbeamt*innen illegal und oft auch gewalttätig Menschen über die Grenze zurück schieben.
Damit läuft die Argumentation der Kommission, bessere Verfahren und angemessene Unterbringung seien aktuell nicht möglich, ins Leere. Denn Polen und Lettland haben bislang noch nicht einmal zur Verfügung stehende europäische Unterstützung, wie zum Beispiel Zelte, Betten und Heizsysteme, wie sie an Litauen gegangen sind, angenommen.
Im einem Verfahren gegen Ungarn vor dem Gerichtshof der Europäischen Union zu den Transitzonen hatte die Kommission 2020 zu Recht noch festgehalten: »Überdies sei der Fall, dass eine große Zahl von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen gleichzeitig internationalen Schutz beantrage, vom Unionsgesetzgeber berücksichtigt worden.« Nur ein Jahr später verteidigt die Kommission bestehendes Recht nicht mehr, sondern beteiligt sich selbst an der Erosion des Flüchtlingsschutzes und der Rechtsstandards in der EU – schon das ist ein Gewinn von Rechtspopulisten in Europa.
Kommission schweigt zu Pushbacks nach Belarus
Aktuell zwingen polnische Grenzschützer*innen die meisten Frauen, Männer und Kinder immer wieder über die Grenze zurück nach Belarus und ignorieren die Versuche der Menschen, Asylanträge zu stellen. In den wenigen Fällen in denen ein Asylantrag tatsächlich registriert wird, werden die Asylsuchenden in (de facto) Haftzentren gebracht (siehe hierzu das Interview mit der polnischen Anwältin Marta Górczyńska).
Nach europäischem Recht muss an offiziellen Grenzübergängen ein Asylantrag gestellt werden können und die Person darf nicht ohne individuelle Prüfung ihres Asylantrags in ein anderes Land abgeschoben werden. Nur durch dieses Verbot von Pushbacks (das sogenannte non-refoulement Gebot), das sich aus Menschenrechtsverträgen wie der Europäischen Menschenrechtskonvention ergibt, kann sichergestellt werden, dass Menschen nicht in Länder gebracht werden, in denen sie gefoltert oder wegen ihrer politischen Haltung, Religion oder sexuellen Orientierung verfolgt werden. Auch die EU-Grundrechtecharta verbietet explizit Kollektivausweisungen, also Abschiebungen ohne individuelle Prüfung (Art. 19 Abs. 1 Grundrechtecharta)
Die krasse Missachtung europäischen Rechts an der polnisch-belarussischen Grenze wurde bislang von der Kommission nur mit Schweigen quittiert. Kritik richtet sich stets an den belarussischen Diktator Lukaschenko, nicht an das EU-Mitgliedland Polen.
In ihrem Vorschlag betont die Kommission mehrfach das non-refoulement Gebot und zielt vermutlich auch mit der Benennung von Registrierungspunkten auf ein Ende der Pushbacks ab. Doch ist eine solche Kehrtwende nicht zu erwarten. Polen dürfte sich durch die Vorschläge der Kommission vielmehr darin bestärkt sehen, mit seiner offensichtlichen Missachtung von Europarecht durchzukommen.
Verfehlte Rechtsgrundlage
Die Kommission will das temporäre »Sonder-Asylrecht« auf eine Grundlage stützen, die bislang nur einmal 2015 mit einer gänzlich anderen Zielrichtung genutzt wurde. Der Artikel 78 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) sieht im Absatz 3 vor:
»Befinden sich ein oder mehrere Mitgliedstaaten aufgrund eines plötzlichen Zustroms von Drittstaatsangehörigen in einer Notlage, so kann der Rat auf Vorschlag der Kommission vorläufige Maßnahmen zugunsten der betreffenden Mitgliedstaaten erlassen. Er beschließt nach Anhörung des Europäischen Parlaments.«
Diese Notfallkompetenz ermöglicht also Maßnahmen außerhalb des regulären europäischen Gesetzgebungsverfahrens, wie es aktuell im Rahmen des »New Pact on Migration and Asylum« erfolgt. Im Jahr 2015 wurde aufgrund der hohen Zahl der Ankünfte von schutzsuchenden Menschen in Griechenland und Italien per Ratsbeschluss auf Basis dieser Norm die Umverteilung (Relocation) von Asylsuchenden aus den beiden Ländern beschlossen. Dies war eine Abweichung von den regulären Zuständigkeitsregeln nach der Dublin-III-Verordnung.
Während 2015 mit der Ratsentscheidung also Solidarität mit den betroffenen Mitgliedstaaten in einer tatsächlichen Ausnahmesituation gezeigt wurde und letztlich auch im Sinne vieler Asylsuchender war, ist von solch praktischer Solidarität im jetzigen Vorschlag der Kommission nichts zu sehen. Auch ist schon allein die Ausgangslage 2015 mit der 2021 schlicht nicht vergleichbar. Suchten 2015 fast eine Million Menschen in Europa Schutz vor Krieg und Verfolgung, geht es aktuell um wenige Tausend Menschen – eine leicht zu bewältigende Situation, wenn der politische Wille da wäre. Es ist eine hausgemachte Krise, die nun als Vorwand für die Aushöhlung des Asylrechts genutzt wird.
Es ist bezeichnend, dass sich Griechenland im März 2020 bezüglich der Aussetzung des Asylrechts durch die vierwöchige Nicht-Registrierung von Asylanträgen auf den gleichen Artikel berufen wollte. Doch damals wurde das europarechtswidrige Vorgehen zumindest von der Kommission nicht rechtlich unterstützt – wenn auch nie öffentlich kritisiert.
Problematische Umgehung des Parlaments
Die Kommission will das »Sonder-Asylrecht« also durch einen Ratsbeschluss herbeiführen. Das Europäische Parlament ist damit außen vor und muss lediglich angehört werden. Besonders brisant: Im Europäischen Parlament wird aktuell der »New Pact on Migration and Asylum« verhandelt und somit auch ganz ähnliche Regelungen im Vorschlag für eine Krisen-Verordnung. Zu dieser hat der zuständige Berichterstatter nur einen Tag vorher, am 30. November 2021, seinen Bericht im zuständigen Ausschuss im Parlament vorgestellt und genau die problematischen Maßnahmen gestrichen, die die EU jetzt am Parlament vorbei temporär einführen will.
Entsprechend empört äußern sich viele Parlamentarier*innen zu dem Vorstoß der Kommission, der vielfach als unverhältnismäßig kritisiert wird (siehe Pressemitteilung und Äußerungen der S&D Fraktion, der Grünen/EFA, der Linken und Renew Europe).
Entscheidung im Rat auch Stresstest für neue deutsche Regierung
Doch noch ist unklar, wie es im Rat mit dem Vorschlag weitergeht. Denn Polen hat bereits signalisiert, dass sie mit dem Vorschlag nicht zufrieden sind – die Asylverfahren sollen laut dem polnischen Botschafter komplett ausgesetzt werden. Der nächste Rat für Inneres und Justiz ist am 9. Dezember 2021, wobei noch nicht feststeht, ob der Vorschlag auf der Tagesordnung steht.
Vermutlich noch vor dem Ratstreffen will die Kommission zudem ihre Reform für den Schengener Grenzkodex vorstellen – wo sich zeigen wird, wie ernst es die Kommission mit dem non-refoulement Gebot tatsächlich meint oder ob sie auch hier nachgeben und gefährliche Ausnahmen schaffen wird. Das wird die Schicksalsfrage für den europäischen Flüchtlingsschutz sein.
Je nach genauem Zeitplan der deutschen Regierungsbildung könnte dies der erste Termin für eine*n neue*n Innenminister*in werden. Im Koalitionsvertrag steht: »Wir wollen die illegalen Zurückweisungen und das Leid an den Außengrenzen beenden«. Die Abstimmung über den Vorschlag der Kommission wird ein erster Stresstest sein, wie ernsthaft sie für Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte in Europa eintritt.